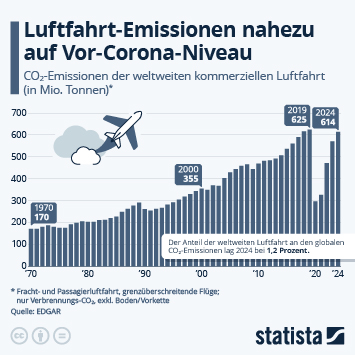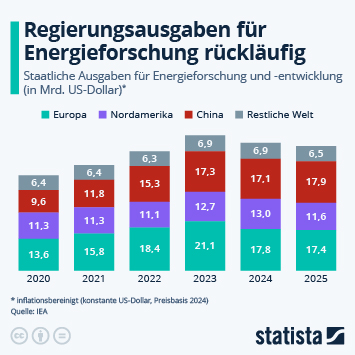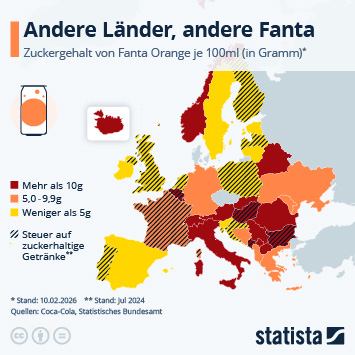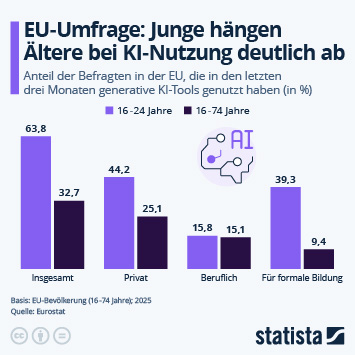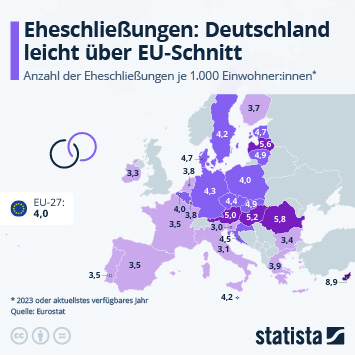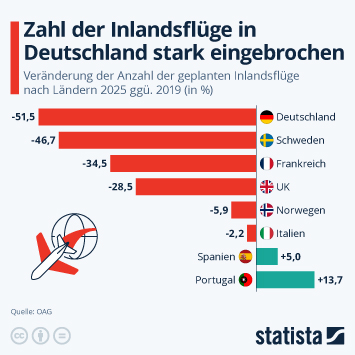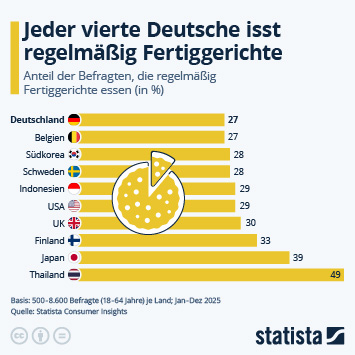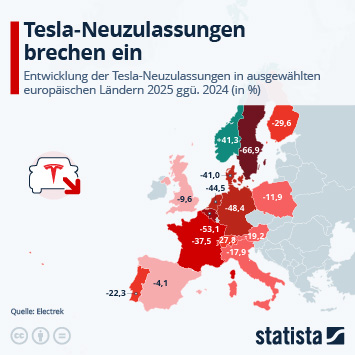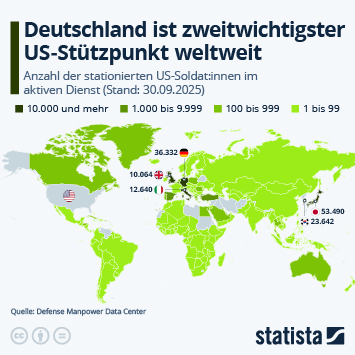Wer zuverlässig und schnell mobil surfen will, sollte nicht in Deutschland leben. Mit einer durchschnittlichen Downloadrate von nur 22,7 Mbps und einer Netzabdeckung von 65,7 Prozent ist das deutsche LTE-Netz eins der Schlusslichter in Europa, wie ein aktueller Vergleich von OpenSignal zeigt.
Insgesamt wurden die Verbindungen in 36 europäischen Ländern untersucht. Spitzenreiter bei der Geschwindigkeit ist mit 42,1 Mbps das niederländische Netz, die höchste Abdeckung hat mit 92,2 Prozent Norwegen. Ebenfalls in die Top Ten schaffen es Bulgarien und Serbien, allerdings mit einer vergleichsweise geringen Netzabdeckung von 74 Prozent und 75,2 Prozent, wie die Grafik von Statista zeigt. Deutschland erreicht bei der Geschwindigkeit Rang 32 und bei der Verfügbarkeit Rang 31.
Die schnellsten LTE-Netze Europas
Mobiles Internet

Beschreibung
Die Grafik zeigt die durchschnittliche 4G-Downloadgeschwindigkeit und -verfügbarkeit