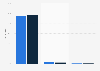Gewalt gegen Frauen in Deutschland und weltweit
Obwohl immer mehr Länder Rechtsnormen gegen Gewalt gegen Frauen erlassen, waren weltweit etwa 307 Millionen Frauen nicht durch das Gesetz gegen häusliche Gewalt geschützt (Stand: 2017). Insbesondere im Nahen Osten und in Nordafrika existieren in den meisten Ländern keine Rechtsnormen, die Frauen vor unterschiedlicher Gewalt schützen. Im Hinblick auf Gerechtigkeit, Integration und Sicherheit von Frauen befindet sich das von der Taliban regierte Afghanistan im Ranking der gefährlichsten Länder für Frauen auf dem ersten Rang, gefolgt vom Bürgerkriegsland Jemen (Stand: 2023). Doch auch in Deutschland ist „Femizid“ kein Straftatbestand und sogenannte Trennungstötungen werden meist als Totschlag anstelle von Mord geahndet. Somit wird suggeriert, dass die Tötung einer Frau durch ihren Ex-Partner kein niedriger Beweggrund sei.Im Jahr 2022 wurden in Deutschland laut Polizeilicher Kriminalstatistik rund 240.000 Opfer von häuslicher Gewalt registriert, davon waren über 170.000 Opfer weiblich. Sowohl bei der Partnerschaftsgewalt als auch bei der innerfamiliären Gewalt sind die Opfer meist Frauen und Mädchen. Bei den Statistiken des BKA werden jedoch lediglich die polizeilich registrierten, also die bekannten Fälle von Partnerschaftsgewalt, berücksichtigt. Es wird von einem hohen Dunkelfeld ausgegangen, da zahlreiche Frauen schweigen und sich weder an eine Beratungsstelle noch an die Polizei wenden.
Hilfe durch Frauenhäuser
Hilfe finden Betroffene in Frauenhäusern, Beratungsstellen oder über Hilfetelefone, die für viele Frauen oft die erste Anlaufstelle sind. Frauenhäuser sind soziale Einrichtungen, die gewaltbetroffenen Frauen und ihren Kindern eine geschützte Unterkunft bieten. Insgesamt gibt es in Deutschland etwa 350 Frauenhäuser und 40 Frauenschutzwohnungen. Die Anzahl der Frauenhausplätze unterscheidet sich stark zwischen den Bundesländern. Die Chance auf Zuflucht ist also nicht überall gleich und häufig stehen zu wenig Betten zur Verfügung. Laut des Familienministeriums gibt es das größte Angebot in den Ballungszentren und Stadtstaaten. Laut Schätzungen der Diakonie suchen hierzulande jedes Jahr etwa 17.000 Frauen mit Gewalterfahrungen Schutz in Frauenhäusern. Betrachtet man zusätzlich die Anzahl ihrer Kinder, wird von rund 34.000 unterzubringenden Personen ausgegangen. Laut des Europarats sollte es hierzulande 21.400 Plätze in solchen Einrichtungen geben. Im Jahr 2019 standen in Deutschland jedoch nur etwa 6.800 Plätze in Frauenhäusern für von Gewalt betroffenen Frauen zur Verfügung.Obgleich viele Datenerhebungen die Fallzahlen von Vergewaltigungen, sexueller Nötigung und anderen Formen von sexualisierter Gewalt festhalten und so zum Beispiel ein Ranking der "gefährlichsten" Länder für Frauen aufstellen können, dürfen diese nicht ohne Kontext gelesen werden. So steht beispielweise Schweden an zweiter Stelle der europäischen Länder mit den meisten Vergewaltigungen pro 100.000 Einwohner, doch hängt die Zahl der registrierten Vergewaltigungen auch immer mit den politischen, sozialen und kulturellen Bedingungen des jeweiligen Landes zusammen. So mag es sein, dass in Schweden generell mehr Möglichkeiten bestehen, oder Anreize gesetzt werden, um sexualisierte Gewalt anzuzeigen. Andererseits können in einem Land mit einer deutlich geringeren registrierten Fallzahl beispielsweise kulturell bedingte Unterschiede einen Einfluss gehabt haben, denn die Anzeigebereitschaft korreliert mit sozialen Werten und Normen. Je geringer die gesellschaftliche Akzeptanz von sexualisierter Gewalt ist, desto eher sind betroffene Menschen bereit, ihre Erfahrungen zu melden. Dementsprechend ist auch das sogenannte Hellfeld umso größer.